|
Im letzten Sommer zeigte das Von der Heydt-Museum
eine große Sonderausstellung zu dem in Elberfeld geborenen Maler.
Am 3. September 2008 besuchten wir das Museum zu einer
Gruppenführung.
Marées wurde 1837 in der Hofaue geboren, lebte aber ab 1847 in
Koblenz, wo sein Vater als Richter arbeitete. Von 1853 bis 1855
studierte der Sohn an der Berliner Akademie, wo er im Atelier des
Pferde- und Militärmalers Karl Steffeck (1818-1890) ausgebildet
wurde. Hier und in Wörlitz malte Marées vornehmlich Pferdebilder
und kleinformatige Landschaften. In der Berliner Zeit entstand
auch sein Selbstbildnis von 1855, das im Besitz des Von der
Heydt-Museums ist.
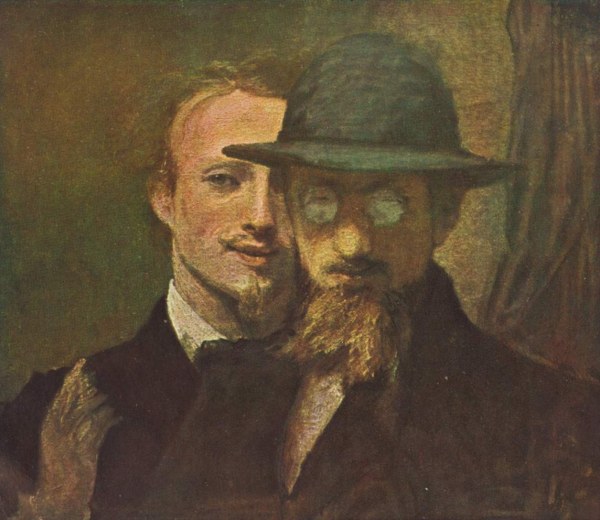 |
| Hans von Marées: Doppelbildnis
Marées und Lenbach (1863) |
1857 verließ er Berlin und zog nach München um, wo er sich sechs
Jahre aufhielt. In der bayrischen Kunstmetropole spielte damals
Karl von Piloty (1826-1886), ein Hauptmeister der realistischen
Historienmalerei, eine führende Rolle. Marées schuf in den
sechziger Jahren einige militärische Genrebilder und
Gefechtsszenen mit Motiven aus den Freiheitskriegen. Außerdem
malte er damals einige beeindruckende Porträts, bei denen das
Licht sich meistens ganz auf die Gesichtszüge konzentriert,
während die übrigen Bildpartien fast völlig im Schatten
verschwinden. 1863 malte Marées ein faszinierendes Doppelporträt
von sich und seinem fast gleichaltrigen Malerkollegen Franz von
Lenbach (1836-1904), einem Schüler von Piloty. Auf dem
Doppelporträt steht Marées zwar im Hintergrund, aber sein Gesicht
strahlt in hellem Licht, während der Kollege vor ihm düster und
verschlossen wirkt. Lenbachs Gesicht wird von der breiten Krempe
seines Hutes beschattet, seine Augen verbergen sich hinter
beschlagenen Brillengläsern.
In München lernte Marées den Grafen Adolf von Schack (1815-1894)
kennen, der viele Maler förderte und eine eigene Gemäldegalerie
einrichtete. In seinem Auftrag reiste Marées im Herbst 1864 nach
Rom, um von vorher festgelegten Werken alter Meister Kopien zu
malen. Auch Lenbach erhielt solche Aufträge. Binnen eines Jahres
malte Marées je ein Werk nach Vorlagen von Palma Vecchio, Tizian,
Veläzquez und Raffael. Aber Marées schuf schon ab dem zweiten Bild
keine möglichst detailgetreuen Kopien mehr - im Gegensatz zu
Lenbach. Daher kam es zum Bruch mit Schack, der den Romaufenthalt
finanziert hatte. Marées geriet anfangs in eine künstlerische
Krise, fand aber neue Anregungen zum Malen in der
Auseinandersetzung mit der italienischen Renaissancemalerei. Er
löste sich nun von anekdotischen und genrehaften Motiven und
wählte allgemeingültige, zeitlose Themen. Seine Bilder wurden nun
von einer rot-braunen Farbigkeit geprägt, die für seine späteren
Schaffensphasen bestimmend wurden.

Bildnis
Konrad Fiedler (1879)
In Rom lernte Marées 1866 den vermögenden
Kunstschriftsteller Konrad Fiedler (1841-1895) kennen, der ihm zum
Freund und Förderer wurde und ihn geldlich sicherstellte. Fiedler
blieb dem reizbaren und verbitterten Künstler bis zu dessen Ende
treu. 1867 traf der junge Bildhauer Adolf von Hildebrand
(1847-1921) mit Marées und Fiedler zusammen und freundete sich mit
beiden an. Die drei Freunde suchten nach der "reinen Form" und
beschäftigten sich intensiv mit der Kunst der Antike.
1869 reiste Marées mit Fiedler nach Spanien und Frankreich. In
Paris wurde er tief beeindruckt von Bildern von Theodore Gericault
und Eugene Delacroix, die ihn zu weiteren Gemälden inspirierten.
Ab 1870 hielt sich Marées wieder in Berlin und 1872 in Dresden auf
und nahm am gesellschaftlichen Leben teil. In diesen Jahren
entstanden wieder manche hervorragende Porträts und
Selbstbildnisse.
1873 erhielt Marées den Auftrag, einen Saal der neu gegründeten
Zoologischen Station in Neapel mit Fresken auszugestalten. Damit
ging sein Wunsch in Erfüllung, seine künstlerischen Ideen auf
großen Flächen zu verwirklichen. Marées schuf fünf Alltagsszenen,
die das Leben der Menschen am Golf von Neapel darstellten, zum
Beispiel die Ausfahrt der Fischer, die Ruderer oder das gesellige
Beisammensein der Freunde im Wirtshaus. Der Bildhauer Hildebrand
schuf die dekorativen Einfassungen und plastischen Arbeiten. Die
Ausstellung zeigte hierzu teils großformatige Ölskizzen in
mehreren Versionen, die Marées anfertigte, ehe er die Fresken im
Einzelnen unmittelbar auf den nassen Putz malte.

Hans von
Marées: Entwurf zum Bild "Das goldene Zeitalter" (1879)
Nach dem Malen der Neapler Fresken hätte Marées
gern weitere derartig großflächige Werke geschaffen. Er erhielt
aber keine diesbezüglichen Aufträge. Er schuf einige
Monumentalgemälde und Triptychen, die aber aus konservatorischen
Gründen nicht vom Museum in München nach Wuppertal transportiert
werden durften. Thematisch hat Marées, der in seinen späten Jahren
den Anspruch hatte, zeitlose Bilder zu malen, oft Motive aus der
antiken Mythologie bearbeitet, wie es auch seine zeitweise in Rom
lebenden Zeitgenossen Arnold Böcklin (1827-1901) und Anselm
Feuerbach (1829-1880) taten. Auf vielen Bildern und Zeichnungen
begegnen uns nackte, meist männliche Figuren in oft paradiesischer
Landschaft.
Zur Vorbereitung seiner Gemälde fertigte Marées zahllose
Ideenskizzen, Vor- und Detailstudien an. Man schätzt, dass es
mehrere tausend waren, von denen aber nur ein Bruchteil erhalten
blieb, da Marées sie nicht systematisch sammelte. Aber auch die
erhaltenen Zeichnungen zeigen eindrucksvoll, wie intensiv der
Künstler sich mit der Ausführung seiner Werke beschäftigte.
Marées starb bereits im 50. Lebensjahr im Juni 1887 in Rom
und wurde auf dem dortigen evangelischen Friedhof bestattet. Das
Grabmal mit einem antikisierenden Relief schuf der Bildhauer Artur
Volkmann (1851-1941). Mit ihm hatte Marées in seinem letzten
Lebensjahrzehnt eng zusammengearbeitet. Der Maler hatte mehrere
Studien für Skulpturen geschaffen, die Volkmann ausführen sollte.
So entstand zum Beispiel Volkmanns Ganymed-Skulptur, die auch in
der Ausstellung stand.
|













